Sich zeigen, die eigene Stimme in den Vordergrund rücken, von sich selbst sprechen: Das gehört nicht unbedingt zum Tagesgeschäft von Übersetzerinnen und Übersetzern. Die PR-Mentorin und Buchautorin Daniela Heggmaier hat nachgeholfen.

Mit dem Mauerblümchendasein hat Daniela Heggmaier Erfahrung, stand sie doch selbst jahrelang im Hintergrund und verhalf als PR-Beraterin anderen zu wirkungsvollen Auftritten. Bis sie 2012 ihren Blog startete. In der Bibliothek des Literaturhauses erklärte sie den zahlreich anwesenden Übersetzer*innen, wie man das Internet und andere „Bühnen“ für die Selbst-PR nutzen kann und das auch noch auf achtsame Weise.
Sichtbar sein
Regel Nr. 1:
Wer sich der Öffentlichkeit wirksam präsentieren möchte, muss sich und seine Arbeit zeigen.
Klingt logisch, ist aber gar nicht so einfach. Mit Verweis auf das Buch Show your work des amerikanischen Autors Austin Kleon, erklärte die Referentin, dass man sich zeigen soll, wie man sein möchte, dann werde man auch so wahrgenommen. „Selbstausdruck“ nennt Heggmaier das. Wer also Künstler*in sein möchte, darf sich auch als Künstler*in präsentieren. Auf Unverwechselbarkeit komme es an. Das fängt bei der individuellen Kleidung an und hört bei den richtigen Fotos noch lange nicht auf.
Beziehungen aufbauen
Wie kann man im Internet, diesem riesigen anonymen Universum, Beziehungen aufbauen?
Zunächst sei es ratsam, sich die Internetcommunity als Unterstützer vorzustellen, als Partnerinnen oder interessierte Kunden. Für den Beziehungsaufbau gebe es klare Regeln. Als erstes gelte: Bleiben Sie positiv. Kritisieren, verurteilen und klagen Sie nicht in Ihren Posts. Eine weitere Grundregel: Geben Sie ehrliche und aufrichtige Anerkennung. Sich für andere zu interessieren, sei enorm wichtig. Dazu kann man Posts von anderen teilen, liken oder wohlwollend kommentieren.
Überzeugungsarbeit
Wie kann man die Menschen, mit denen man auf diese Weise in Kontakt getreten ist, dann von sich überzeugen? Dazu sollte man zuhören, stets freundlich sein und die Meinung anderer achten. Man dürfe die Community aber auch gern zum Wettbewerb herausfordern, die eigenen Kompetenzen und Leistungen zeigen. Die wirkungsvollste Weise, das zu tun, sei empathisch zu bleiben. Auf folgende Fragen komme es dabei an:
Welche meiner Kompetenzen nützen anderen? Wie kann ich helfen?
Das ist die so genannte Füllhorn-Strategie, die nichts anderes beinhaltet, als großzügig Wissen an andere weiterzugeben, Denkanstöße und Wissenswertes zu teilen und zu posten. Aber auch selbst Fragen stellen und aktiv Hilfe suchen komme gut an. Geben und Nehmen sei ein wichtiger Grundsatz. Der eigene Blog oder Email-Newsletter ist z.B. ein wirkungsvolles Instrument, die eigenen Kompetenzen zu zeigen und Wissen zu teilen. Man erreiche damit oft mehr Menschen als über Social-Media-Kanäle.
Sieben Säulen
Weiter ging es mit den sogenannten „Sieben Säulen der Selbst-PR“. Eine wichtige Frage hier:
Wie kann ich mich zur Marke machen?
Joseph Beuys‘ Hut oder Hans-Dietrich Genschers gelber Pullover sind besonders prägnante Beispiele für persönliche Markenzeichen, die in der Erinnerung haften bleiben.
Aber es geht nicht nur ums Äußere, auch persönliche Werte sollte man kommunizieren und die eigenen Fachgebiete herausstellen. Andere können einen dabei unterstützen, eine „Marke“ zu werden. Es sei z.B. sinnvoll, um Rückmeldung zu bitten, welche Qualitäten andere an einem selbst wahrnehmen. Denn die eigene Außenwirkung kennt man selbst meist nicht.
Danach ging es um das sogenannte persönliche „Warum“. Wie habe ich mein Talent überhaupt entdeckt? Wie bin ich geworden, was ich bin? Über diese Fragen lohne es sich, nachzudenken und die Antworten dann zu kommunizieren. „Storytelling“ nennt sich das. (weiterführende Informationen dazu bei Simon Sinek Start with why).
Aber – wie man spätestens seit Gottfried Keller weiß – Kleider machen eben doch Leute. Den eigenen Stil zu finden sei wichtig. Sich in individueller Kleidung zu präsentieren, in der man sich wohl fühlt, erzeuge positive Resonanz bei anderen. Zur Außenwirkung gehören auch fantasievolle Visitenkarten und vor allem gute Fotos. Dafür lohne es sich auch, etwas Geld auszugeben.
 Eine weitere Säule: ein gutes Netzwerk. Die eigene Webseite, die Nutzung von Social-Media-Kanälen oder beruflichen Netzwerken wie LinkedIn helfen, es aufzubauen. Ein besonders wirkungsvolles Werkzeug sei der Blog. Personality-Blogs, wie Heggmaier sie bezeichnet, förderten die eigene Sichtbarkeit im Netz und seien eine Gelegenheit, die eigene Kreativität zu zeigen. Aber bitte immer auf Kontinuität achten und regelmäßig bloggen.
Eine weitere Säule: ein gutes Netzwerk. Die eigene Webseite, die Nutzung von Social-Media-Kanälen oder beruflichen Netzwerken wie LinkedIn helfen, es aufzubauen. Ein besonders wirkungsvolles Werkzeug sei der Blog. Personality-Blogs, wie Heggmaier sie bezeichnet, förderten die eigene Sichtbarkeit im Netz und seien eine Gelegenheit, die eigene Kreativität zu zeigen. Aber bitte immer auf Kontinuität achten und regelmäßig bloggen.
Auch Medienarbeit ist eine Säule der Selbst-PR. Man kann an Presseevents teilnehmen, versuchen, Journalistinnen und Journalisten für die eigene Arbeit zu begeistern und signalisieren, dass man für Interviews und Vorträge zur Verfügung steht. Als Übersetzerin könne man auch mal mit dem Gedanken spielen, ein eigenes Buch zu schreiben, schließlich hat man ja gute Verlagskontakte.
Achtsam sein
Für Selbst-PR braucht man Mut. Das bedeute aber nicht, sich zu verbiegen, um aufzufallen oder Dinge zu tun, mit denen man sich unwohl fühlt. Für jeden Typ, ob introvertiert oder extrovertiert, gebe es die passenden Strategien und Kanäle. Wer eher kontaktfreudig und mitteilsam ist, kann z.B. einen Youtube-Kanal oder TikTok für sich nutzen.
Kontinuität zu achten, sich also regelmäßig über seine Kanäle zu äußern. Das signalisiert Professionalität.
Questions & Answers
 Zum Schluss kamen noch Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über ihre Eintragung in die Datenbank des VDÜ schon Aufträge bekommen habe. Fast alle Teilnehmer*innen sprachen von der Wirksamkeit des Vitamins B. Hier sei, so Heggmaier, eine gut gepflegte Webseite wichtig, denn damit mache man sich „empfehlbar“. Sie sei wie eine Visitenkarte und zudem ein Service, der alle Informationen zur Person für potenzielle Kunden bündele.
Zum Schluss kamen noch Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über ihre Eintragung in die Datenbank des VDÜ schon Aufträge bekommen habe. Fast alle Teilnehmer*innen sprachen von der Wirksamkeit des Vitamins B. Hier sei, so Heggmaier, eine gut gepflegte Webseite wichtig, denn damit mache man sich „empfehlbar“. Sie sei wie eine Visitenkarte und zudem ein Service, der alle Informationen zur Person für potenzielle Kunden bündele.
Insgesamt ging man mit dem Gefühl nach Hause, dass man mit Stetigkeit und Authentizität schon viel im Netz erreichen kann. Ein durchaus beruhigendes und motivierendes Gefühl.
(c) 2019 Sabine Voß


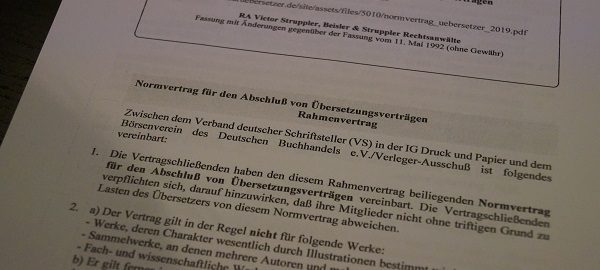



 Letztlich, so Halfon, sei die Hauptfigur des Buches der See, ein Spiegel für Land und Leute. Ein See, in dem immer wieder Kinder ertrinken – so erst letzte Woche – arme Kinder, für deren Schicksal und Namen sich niemand interessiere. So werde dieser See zum Sinnbild für nicht eingestandene Schuld. Der Erzähler in Duell erlebt persönliche Schuld, doch er erfährt auch Erlösung, Ekstase. Doch wenn es schon als Individuum so schwer fällt, sich Schuld einzugestehen, wie viel schwerer muss es dann für ein ganzes Land sein?, stellt Halfon die Frage in den Raum und macht damit den Raum auf für neue Fragen, denen er womöglich in künftigen Erzählungen nachgeht. Aus jedem seiner Bücher schöpfen sich Geschichten für neue Bücher, so der Autor, der bereits an einem neuen Roman arbeitet. Wovon er handeln wird, bleibt er wie so viele andere Auflösungen an diesem Abend schuldig. Doch eines ist sicher: Es wird ein weiterer Mosaikstein sein, mit dem sich die novela total, der „totale Roman“, an dem Halfon nach eigener Aussage arbeitet, zu einem Gesamtpanorama zusammensetzt.
Letztlich, so Halfon, sei die Hauptfigur des Buches der See, ein Spiegel für Land und Leute. Ein See, in dem immer wieder Kinder ertrinken – so erst letzte Woche – arme Kinder, für deren Schicksal und Namen sich niemand interessiere. So werde dieser See zum Sinnbild für nicht eingestandene Schuld. Der Erzähler in Duell erlebt persönliche Schuld, doch er erfährt auch Erlösung, Ekstase. Doch wenn es schon als Individuum so schwer fällt, sich Schuld einzugestehen, wie viel schwerer muss es dann für ein ganzes Land sein?, stellt Halfon die Frage in den Raum und macht damit den Raum auf für neue Fragen, denen er womöglich in künftigen Erzählungen nachgeht. Aus jedem seiner Bücher schöpfen sich Geschichten für neue Bücher, so der Autor, der bereits an einem neuen Roman arbeitet. Wovon er handeln wird, bleibt er wie so viele andere Auflösungen an diesem Abend schuldig. Doch eines ist sicher: Es wird ein weiterer Mosaikstein sein, mit dem sich die novela total, der „totale Roman“, an dem Halfon nach eigener Aussage arbeitet, zu einem Gesamtpanorama zusammensetzt.

 Am 12. Dezember dieses Jahres stellte die ehemalige Vorsitzende Regina Rawlinson drei Übersetzerinnen vor, die, wie sich sehr zur Erheiterung des Publikums herausstellte, alle den Nachnamen Ott tragen. Ob die Kolleginnen aufgrund dessen ausgewählt wurden, sei dahingestellt; fest steht, dass Reginas charmante Moderation sowie die nicht minder charmanten vorgestellten Damen den Abend zu einem sehr interessanten und äußerst kurzweiligen machten.
Am 12. Dezember dieses Jahres stellte die ehemalige Vorsitzende Regina Rawlinson drei Übersetzerinnen vor, die, wie sich sehr zur Erheiterung des Publikums herausstellte, alle den Nachnamen Ott tragen. Ob die Kolleginnen aufgrund dessen ausgewählt wurden, sei dahingestellt; fest steht, dass Reginas charmante Moderation sowie die nicht minder charmanten vorgestellten Damen den Abend zu einem sehr interessanten und äußerst kurzweiligen machten. Sie habe so einige „Regalmeter“ und „Bücher, die sich gut stapeln lassen“ übersetzt, erzählt Bernadette. Etwas später seien dann über Kontakte Bilderbücher zu ihrer mittlerweile sehr beeindruckenden Veröffentlichungsliste hinzugekommen. Sie schmunzelt, „Bilderbücher übersetzen“, das gehe ja an und für sich gar nicht. Doch dann fängt Bernadette an, ein bisschen über ihre Erfahrungen mit dem Genre zu berichten, und es ist eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie ins Schwelgen gerät. Im Prinzip hätten Bilderbücher sehr viel mit Lyrik gemeinsam, die Sprache sei sehr schön ,und es herrsche eine „teilweise sehr literarische Konzentration von Lyrik“, wobei sich zusätzlich „die Lyrik und das Visuelle auf einer ganz anderen Ebene kreuzen“. Natürlich gibt es bei Bilderbüchern ebenso übersetzungspraktische Hürden zu überwinden wie bei allen anderen Texten. So müssen selbstverständlich die Illustrationen und das Layout berücksichtigt oder landesspezifische Anpassungen bei Flora und Fauna gemacht werden.
Sie habe so einige „Regalmeter“ und „Bücher, die sich gut stapeln lassen“ übersetzt, erzählt Bernadette. Etwas später seien dann über Kontakte Bilderbücher zu ihrer mittlerweile sehr beeindruckenden Veröffentlichungsliste hinzugekommen. Sie schmunzelt, „Bilderbücher übersetzen“, das gehe ja an und für sich gar nicht. Doch dann fängt Bernadette an, ein bisschen über ihre Erfahrungen mit dem Genre zu berichten, und es ist eine Freude, ihr dabei zuzusehen, wie sie ins Schwelgen gerät. Im Prinzip hätten Bilderbücher sehr viel mit Lyrik gemeinsam, die Sprache sei sehr schön ,und es herrsche eine „teilweise sehr literarische Konzentration von Lyrik“, wobei sich zusätzlich „die Lyrik und das Visuelle auf einer ganz anderen Ebene kreuzen“. Natürlich gibt es bei Bilderbüchern ebenso übersetzungspraktische Hürden zu überwinden wie bei allen anderen Texten. So müssen selbstverständlich die Illustrationen und das Layout berücksichtigt oder landesspezifische Anpassungen bei Flora und Fauna gemacht werden. Johanna Ott ist die zweite, ebenfalls aus Bayern stammende Übersetzerin des Abends und mit zarten 35 Jahren zugleich die jüngste. Sie übersetzt aus dem Englischen und Spanischen, und man darf sich von ihrer scheinbar kurzen Karriere nicht täuschen lassen – seit 2016 hat sie beachtliche zehn Veröffentlichungen vorzuweisen. Bereits zu Schulzeiten wurde Johanna eine Liebe für Fremdsprachen und Literatur mit auf den Weg gegeben, der daraufhin zum Magisterstudium der Neueren Deutschen Literatur, englischer Literaturwissenschaft und Ethnologie führte (mit Abstechern in die Psychologie, Komparatistik und Romanistik). Weiter ging es 2012 nach Guatemala zu einem Freiwilligenprojekt, für das die spanischen Werkzeug-Vokabeln vergeblich gelernt wurden, denn die Bohrmaschine war schlicht „la Bosch“.
Johanna Ott ist die zweite, ebenfalls aus Bayern stammende Übersetzerin des Abends und mit zarten 35 Jahren zugleich die jüngste. Sie übersetzt aus dem Englischen und Spanischen, und man darf sich von ihrer scheinbar kurzen Karriere nicht täuschen lassen – seit 2016 hat sie beachtliche zehn Veröffentlichungen vorzuweisen. Bereits zu Schulzeiten wurde Johanna eine Liebe für Fremdsprachen und Literatur mit auf den Weg gegeben, der daraufhin zum Magisterstudium der Neueren Deutschen Literatur, englischer Literaturwissenschaft und Ethnologie führte (mit Abstechern in die Psychologie, Komparatistik und Romanistik). Weiter ging es 2012 nach Guatemala zu einem Freiwilligenprojekt, für das die spanischen Werkzeug-Vokabeln vergeblich gelernt wurden, denn die Bohrmaschine war schlicht „la Bosch“. Andrea beginnt entwaffnend ehrlich: Zum Übersetzen sei sie unter anderem gekommen, weil sie früher selber Bücher habe schreiben wollen; doch dann die Feststellung: „Ich hab nix zu sagen“. Glauben mag man das nicht so recht, wenn man ihr dabei zuhört, wie sie von ihrem ersten Auftrag erzählt. Shirley von Charlotte Brontë hat sie übersetzt. Erstmal einfach so (und auf den spontanen Vorschlag ihrer Mutter hin), um zu sehen, wie es denn sei. Nach ein paar Kapiteln marschierte sie mit ihrer Übersetzung zum Manesse Verlag und zur richtigen Lektorin, einer „Heiligen“, und 1989 wurde Andrea schließlich mit Shirley zum ersten Mal veröffentlicht. Auch ihre übrige Vita lässt nicht glauben, dass Andrea nichts zu sagen hat. Als Regieassistentin und Dramaturgin hat sie gearbeitet, ein Programmkino aufgebaut und betrieben, ist Mutter von zwei Kindern. Und seit 1986 Übersetzerin mit der Sprachkombination English–Deutsch.
Andrea beginnt entwaffnend ehrlich: Zum Übersetzen sei sie unter anderem gekommen, weil sie früher selber Bücher habe schreiben wollen; doch dann die Feststellung: „Ich hab nix zu sagen“. Glauben mag man das nicht so recht, wenn man ihr dabei zuhört, wie sie von ihrem ersten Auftrag erzählt. Shirley von Charlotte Brontë hat sie übersetzt. Erstmal einfach so (und auf den spontanen Vorschlag ihrer Mutter hin), um zu sehen, wie es denn sei. Nach ein paar Kapiteln marschierte sie mit ihrer Übersetzung zum Manesse Verlag und zur richtigen Lektorin, einer „Heiligen“, und 1989 wurde Andrea schließlich mit Shirley zum ersten Mal veröffentlicht. Auch ihre übrige Vita lässt nicht glauben, dass Andrea nichts zu sagen hat. Als Regieassistentin und Dramaturgin hat sie gearbeitet, ein Programmkino aufgebaut und betrieben, ist Mutter von zwei Kindern. Und seit 1986 Übersetzerin mit der Sprachkombination English–Deutsch.
 In diesem Sinne: Herzlichen Dank an Regina, Bernadette, Johanna und Andrea – und natürlich an alle, die wieder großzügig für den Büchertisch gespendet haben! Euch und allen anderen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen schmucken Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches 2020!
In diesem Sinne: Herzlichen Dank an Regina, Bernadette, Johanna und Andrea – und natürlich an alle, die wieder großzügig für den Büchertisch gespendet haben! Euch und allen anderen frohe Weihnachten, besinnliche Feiertage und einen schmucken Rutsch in ein gesundes und erfolgreiches 2020!

 Eine weitere Säule: ein gutes
Eine weitere Säule: ein gutes  Zum Schluss kamen noch Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über ihre Eintragung in die Datenbank des VDÜ schon Aufträge bekommen habe. Fast alle Teilnehmer*innen sprachen von der Wirksamkeit des Vitamins B. Hier sei, so Heggmaier, eine gut gepflegte Webseite wichtig, denn damit mache man sich „empfehlbar“. Sie sei wie eine Visitenkarte und zudem ein Service, der alle Informationen zur Person für potenzielle Kunden bündele.
Zum Schluss kamen noch Fragen und Anregungen aus dem Publikum. Eine Teilnehmerin berichtete, dass sie über ihre Eintragung in die Datenbank des VDÜ schon Aufträge bekommen habe. Fast alle Teilnehmer*innen sprachen von der Wirksamkeit des Vitamins B. Hier sei, so Heggmaier, eine gut gepflegte Webseite wichtig, denn damit mache man sich „empfehlbar“. Sie sei wie eine Visitenkarte und zudem ein Service, der alle Informationen zur Person für potenzielle Kunden bündele.
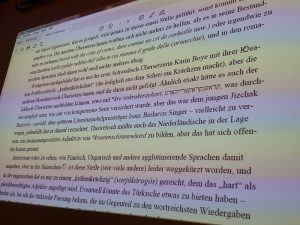 Zum Thema Umgang mit „Unübersetzbarem“ hatte das MÜF Burkhart Kroeber am 10. Oktober ins gut besuchte Forum des Literaturhauses geladen. Es sollte an diesem Abend aber weder um Umberto Eco noch um Calvino oder Manzoni gehen, sondern darum, wie Übersetzerinnen und Übersetzer auf der ganzen Welt „eine besonders eigenwillige und einzigartige Stelle in Thomas Manns Zauberberg“ behandelt haben. Kroeber erzählte, wie er den Roman zum ersten Mal als 19-Jähriger gelesen habe, aber damals noch völlig unschuldig und nicht durch die Brille des Übersetzers. Bei einer Zweitlektüre, viele Jahre später, blieb der inzwischen bekannte Eco-Übersetzer nach ca. 780 Seiten plötzlich an einer Textstelle hängen: „ … kahles Geäst, das draußen in eisige, krähenschreiharte Nebelfrühe starrt“ (Der Zauberberg, Teil VII, Kap. Vingt et un, ca. 3 Seiten vor dessen Ende), und stellte sich die Frage: Wie haben die Kolleg*innen das bloß in ihre Sprachen gebracht?
Zum Thema Umgang mit „Unübersetzbarem“ hatte das MÜF Burkhart Kroeber am 10. Oktober ins gut besuchte Forum des Literaturhauses geladen. Es sollte an diesem Abend aber weder um Umberto Eco noch um Calvino oder Manzoni gehen, sondern darum, wie Übersetzerinnen und Übersetzer auf der ganzen Welt „eine besonders eigenwillige und einzigartige Stelle in Thomas Manns Zauberberg“ behandelt haben. Kroeber erzählte, wie er den Roman zum ersten Mal als 19-Jähriger gelesen habe, aber damals noch völlig unschuldig und nicht durch die Brille des Übersetzers. Bei einer Zweitlektüre, viele Jahre später, blieb der inzwischen bekannte Eco-Übersetzer nach ca. 780 Seiten plötzlich an einer Textstelle hängen: „ … kahles Geäst, das draußen in eisige, krähenschreiharte Nebelfrühe starrt“ (Der Zauberberg, Teil VII, Kap. Vingt et un, ca. 3 Seiten vor dessen Ende), und stellte sich die Frage: Wie haben die Kolleg*innen das bloß in ihre Sprachen gebracht? Über den Beamer sahen wir uns die Textstellen im Einzelnen an, „nicht um sie hochnäsig zu kritisieren oder uns über sie lustig zu machen“, so Kroeber, „sondern um etwas über die Eigenarten der jeweiligen Sprachen zu lernen.“ Und wir erkannten schnell: Die problemlos mögliche Agglutination aus „Krähe“ + „schreien + „hart“ im Deutschen stellt andere Sprachen vor höchste übersetzerische Herausforderungen.
Über den Beamer sahen wir uns die Textstellen im Einzelnen an, „nicht um sie hochnäsig zu kritisieren oder uns über sie lustig zu machen“, so Kroeber, „sondern um etwas über die Eigenarten der jeweiligen Sprachen zu lernen.“ Und wir erkannten schnell: Die problemlos mögliche Agglutination aus „Krähe“ + „schreien + „hart“ im Deutschen stellt andere Sprachen vor höchste übersetzerische Herausforderungen. Und wie verhält es sich in anderen agglutinierenden Sprachen wie dem Finnischen, dem Ungarischen oder dem Türkischen? In der finnischen Übersetzung wurde die Textstelle schlichtweg gestrichen, im Ungarischen habe es nur zu einem „krähenkrächzig“ und einem separaten „hart“ gereicht, und in der türkischen Übersetzung von 2002 sei eine der wortreichsten Versionen überhaupt entstanden, sehe man einmal von den ostasiatischen Sprachen ab (und dort ginge es strukturell eben nicht anders). So erinnern die beiden japanischen Versionen Kroeber in ihrer künstlerischen Freiheit fast schon an die Übersetzung des durch die Welt gewanderten Goethe-Gedichts „Über allen Gipfeln ist Ruh’“ – „Und dann war’s am Ende irgendein Haiku!“. Und was wurde schließlich aus den armen Krähen, die Lowe-Porter aus ihrer Erstübersetzung geschmissen hatte?
Und wie verhält es sich in anderen agglutinierenden Sprachen wie dem Finnischen, dem Ungarischen oder dem Türkischen? In der finnischen Übersetzung wurde die Textstelle schlichtweg gestrichen, im Ungarischen habe es nur zu einem „krähenkrächzig“ und einem separaten „hart“ gereicht, und in der türkischen Übersetzung von 2002 sei eine der wortreichsten Versionen überhaupt entstanden, sehe man einmal von den ostasiatischen Sprachen ab (und dort ginge es strukturell eben nicht anders). So erinnern die beiden japanischen Versionen Kroeber in ihrer künstlerischen Freiheit fast schon an die Übersetzung des durch die Welt gewanderten Goethe-Gedichts „Über allen Gipfeln ist Ruh’“ – „Und dann war’s am Ende irgendein Haiku!“. Und was wurde schließlich aus den armen Krähen, die Lowe-Porter aus ihrer Erstübersetzung geschmissen hatte?

 Die Übersetzerin bezog das Publikum unmittelbar in ihre Überlegungen ein. Schon die ersten drei Worte „1992, Kiew, Ukraine“ lösten eine angeregte Debatte aus: Setzt man im Deutschen die Jahreszahl nicht eher ans Ende, also „Kiew, Ukraine, 1992“? Ist die Reihenfolge „Stadt, Land“ nicht dem Amerikanischen geschuldet (Cambridge, Massachusetts), also doch „Ukraine, Kiew, 1992“? Könnte der Zusatz „Ukraine“ im Deutschen nicht gleich ganz entfallen, da er vielleicht für die amerikanische Leserschaft wichtig ist, für deutsche Leser*innen aber womöglich komisch wirkt (wie „Paris, Frankreich“)?
Die Übersetzerin bezog das Publikum unmittelbar in ihre Überlegungen ein. Schon die ersten drei Worte „1992, Kiew, Ukraine“ lösten eine angeregte Debatte aus: Setzt man im Deutschen die Jahreszahl nicht eher ans Ende, also „Kiew, Ukraine, 1992“? Ist die Reihenfolge „Stadt, Land“ nicht dem Amerikanischen geschuldet (Cambridge, Massachusetts), also doch „Ukraine, Kiew, 1992“? Könnte der Zusatz „Ukraine“ im Deutschen nicht gleich ganz entfallen, da er vielleicht für die amerikanische Leserschaft wichtig ist, für deutsche Leser*innen aber womöglich komisch wirkt (wie „Paris, Frankreich“)?


 Eine kleine, aber feine Gruppe von ÜbersetzerInnen hatte sich am Donnerstag, den 11. Juni 2019 im Literaturhaus eingefunden, um sich gemeinsam den Herausforderungen zu stellen, die „Satzungetüme“ mit sich bringen können. Unter der Anleitung von Ursula Wulfekamp sollte anhand von Beispielen erarbeitet werden, wie man Sätzen zu Leibe rücken kann, die kein Ende nehmen wollen.
Eine kleine, aber feine Gruppe von ÜbersetzerInnen hatte sich am Donnerstag, den 11. Juni 2019 im Literaturhaus eingefunden, um sich gemeinsam den Herausforderungen zu stellen, die „Satzungetüme“ mit sich bringen können. Unter der Anleitung von Ursula Wulfekamp sollte anhand von Beispielen erarbeitet werden, wie man Sätzen zu Leibe rücken kann, die kein Ende nehmen wollen. Nach diesem kurzen Brainstorming ging es ans Eingemachte: Neun Beispiele hatte die Workshopleiterin zusammengestellt, wobei einige aus eigenen, andere aus Projekten einzelner Workshop-TeilnehmerInnen stammten. Zunächst wurde auf die englischen Originale eingegangen: Man klärte Fragen zu einzelnen Ausdrücken sowie zum Kontext, machte Vorschläge, diskutierte, verfeinerte oder verwarf diese wieder, bevor man schließlich einen Blick auf die bereitgestellte deutsche Übersetzung warf.
Nach diesem kurzen Brainstorming ging es ans Eingemachte: Neun Beispiele hatte die Workshopleiterin zusammengestellt, wobei einige aus eigenen, andere aus Projekten einzelner Workshop-TeilnehmerInnen stammten. Zunächst wurde auf die englischen Originale eingegangen: Man klärte Fragen zu einzelnen Ausdrücken sowie zum Kontext, machte Vorschläge, diskutierte, verfeinerte oder verwarf diese wieder, bevor man schließlich einen Blick auf die bereitgestellte deutsche Übersetzung warf.

 Im zweiten Teil des Abends stand der Beruf des literarischen Übersetzers im Vordergrund. Ich stellte meinen eigenen Werdegang und Arbeitsalltag kurz vor. Im Anschluss konnte jede Schülerin und jeder Schüler eine Frage an die Profis im Publikum stellen. Diese standen uns tapfer Rede und Antwort, sodass auch die zuhörenden Eltern und Lehrer einen differenzierten Einblick in das Berufsbild bekamen. Zum Abschluss gab es unter lebhaftem Applaus noch ein Teilnahmezertifikat und den Roman als Geschenk in der berechtigten Hoffnung, dass die jungen Übersetzer ihn auf Englisch zu Ende lesen.
Im zweiten Teil des Abends stand der Beruf des literarischen Übersetzers im Vordergrund. Ich stellte meinen eigenen Werdegang und Arbeitsalltag kurz vor. Im Anschluss konnte jede Schülerin und jeder Schüler eine Frage an die Profis im Publikum stellen. Diese standen uns tapfer Rede und Antwort, sodass auch die zuhörenden Eltern und Lehrer einen differenzierten Einblick in das Berufsbild bekamen. Zum Abschluss gab es unter lebhaftem Applaus noch ein Teilnahmezertifikat und den Roman als Geschenk in der berechtigten Hoffnung, dass die jungen Übersetzer ihn auf Englisch zu Ende lesen.